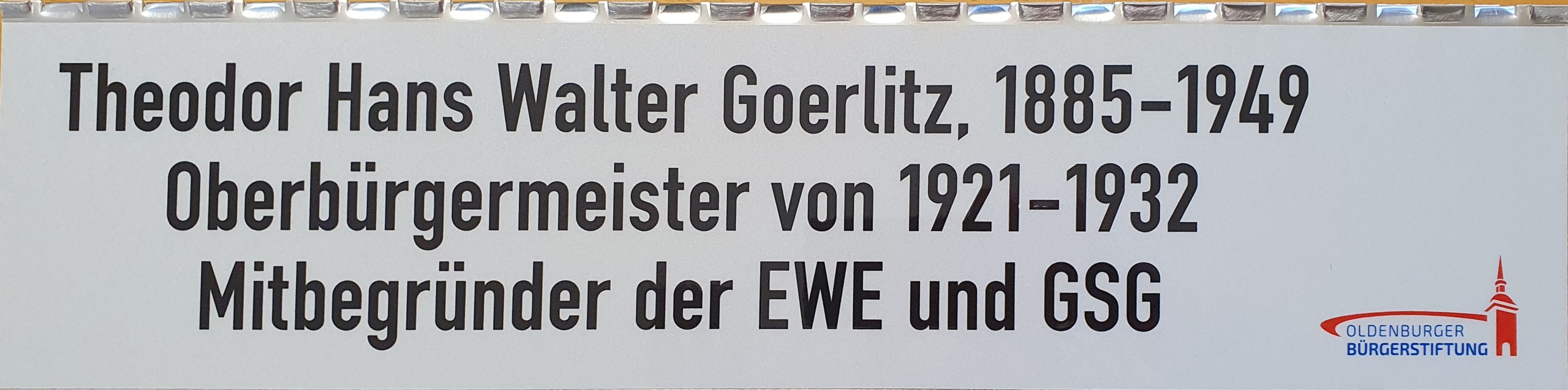Rede von Herrn Schütz zur Einweihung der Erinnerungszeichen am 09. November 2023
Wie in den Vorjahren wollen wir auch heute am 9. Nov. wieder zum 3. Mal Erinnerungszeichen an den Wohnhäusern unserer ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in die Stadt bringen.
Ursprünglich hatten wir zusammen mit der Stadt gehofft, dass Nachkommen der Familie Insel aus der Roggemannstraße 25 mit uns die diesjährige Veranstaltung eröffnen. Dies vor allem deshalb, weil die Stadt den Erinnerungsakt mit einer Rückgabe von Teilen ihres Eigentums verbinden wollte, das sich jetzt im Besitz des Stadtmuseums befindet. Die Tickets für die Flüge waren bereits gebucht, die Hotelzimmer reserviert – aber der Krieg in Israel hat unsere Pläne zerschlagen. Wir müssen diesen Termin verschieben.
Gleichwohl wollten wir die Eröffnungsveranstaltung für die Installierung einer 3. Tranche der Erinnerungszeichen hier im Rathaus aufrechterhalten, weil gerade in den Zeiten des Krieges unsere Erinnerungsarbeit einen auch neuen Sinn bekommt. Dazu aber gleich!
Ich darf in einigen Sätzen daran erinnern, weshalb die Oldenburger Bürgerstiftung zusammen mit Werkstattfilm und gemeinsam mit der Stadt Oldenburg das „Erinnern auf Augenhöhe“ durchführen und worauf wir diesmal unseren Schwerpunkt setzen. Die oldenburgische jüdische Gemeinde hatte damals unter dem Vorsitz von Sarah Ruth Schumann zusammen mit der jüdischen Gemeinde in München die bundesweit laufende Aktion der „Stolpersteine“ abgelehnt. Sie wissen, vor den Häusern jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger sollten diese verlegt werden, um an deren Wohnungen mitten unter uns zu erinnern. Die Gemeinden lehnten dies deshalb ab, weil die bodennahen Stolpersteine mit den Namen der Ermordeten viel zu leicht absichtlich beschmutzt und mit Füßen betreten werden könnten. Diese Ablehnung wollten und mussten wir akzeptieren! Um trotzdem die Erinnerung an die Wohnungen mitten unter uns zu gewährleisten und nicht nur in einer Sammeltafel darauf hinzuweisen, haben wir diese „Erinnerungszeichen auf Augenhöhe„ in Absprache mit den Städten München und Oldenburg übernommen. Abweichend vom Münchener Modell bezahlen unsere Bürger diese Zeichen in Form von Spenden und Sponsoring selbst und nicht die Stadt. Unsere Absicht ist es, das ehemals jüdische Leben in unserer Stadt zu zeigen, es quasi mit Hilfe der heutigen Bürger wieder zurückzuholen und so dem „Nie wieder„ an Hand der aufgezeigten jüdischen Wohnhäuser eine Anschauung zu geben.
Wir wollen diesmal mit Siegfried Weinberg beginnen!
Er hat in der Nordstraße 2 gewohnt und in der Haarenstraße 15 sein Geschäft, eine Honig- und Wachshandlung, betrieben. Gleichzeitig war hier auch die Annahmestelle seiner Wäscherei Edelweiß, deren Hauptstelle in der Uferstraße, in der Nähe seiner Wohnung lag. Das Geschäftshaus existierte schon lange vor Siegfried Weinberg und gehörte seinem Großvater Salomon Josef Ballin, der hier die Firma S.J. Ballin & Co. betrieben hatte. Das Gründungsdatum dieser Firma ist vermutlich 1812/1813. Damit gehört diese Firma zu den ältesten jüdischen Geschäften Oldenburgs.
Wir haben im vorigen Jahr schon an Siegfried Weinbergs Tochter Erna gedacht, die den Geschäftsmann Leopold Liepmann in der Schüttingstraße 20 geheiratet hatte. An sie erinnert dort ein Erinnerungszeichen. Alle, nämlich Siegfried Weinberg, seine Tochter Erna und Leopold Liepmann wurden, nachdem sie vergeblich in die Niederlande geflohen waren, von dort über das Sammellager Westerbrok ( Holland) nach Sobibor transportiert und dort ermordet.
Jörg Witte, den ich hier herzlich begrüße, hatte im vorigen Jahr Liepmanns Enkeltochter Ingrid, verheiratete Heimann, in Florida aufgetan. Sie hatte Auschwitz und die nachfolgenden Todesmärsche überlebt, ist aber mittlerweile verstorben. Jahrzehnte später hat Steven Spielberg im Rahmen der Dokumentationen der Shoa-Foundation ihre Erlebnisse aufgezeichnet. Damit ist ein zweistündiges Interview als Zeitdokument der Oldenburgerin Ingrid Heimann erhalten geblieben. Ihre Tochter Teri Heimann (also Siegfried Weinbergs Urenkelin) lebt heute noch in den USA und hat zu Jörg Witte Kontakt. Teri Heimann Rappaport ist über unsere Gedenkveranstaltung informiert und im Geiste bei uns. Aufgrund ihrer Krankheit kann sie aber nicht kommen.
Meine Damen und Herren,
wir werden gleich, wie in den Vorjahren, heute nur exemplarisch in der Haarenstraße 15 und in der Nordstraße 2 für Siegfried Weinberg die Erinnerungszeichen anbringen – wozu ich sie herzlich einlade – dann werden wir noch mehr über die Familie Weinberg hören.
In den nächsten Wochen, bis zum 27. Januar, dem Auschwitzgedenktag, werden wir die weiteren Erinnerungszeichen anbringen. Zusätzlich sind dies:
- In der Achterstraße 62 die Wohnung von Rosa Herzberg und Gertrud Meyerstein.
- Rosa Herzberg ist im Ghetto Theresienstadt am 29.3. 1942 ermordet worden; Gertrud Meyerstein ist im KZ Auschwitz ermordet worden. Ihr Todesdatum ist unbekannt.
- In der Bismarkstrße 25 erinnern wir an Karolina Katz. Sie wurde im Ghetto Riga ermordet, ihr Todesdatum ist uns nicht bekannt.
- In der Gottorpstraße 15a erinnern wir an Normann Hesse, deportiert ins Ghetto Minsk, sein Todesdatum ist uns nicht bekannt.
- Aus der Gottorpstraße 15a wurden ebenfalls seine Ehefrau Margarete Hesse, geb. Meyer und ihre Kinder Lea Hesse und Manfred Hesse ins Ghetto Minsk deportiert. Alle wurden ermordet.
- In der Grünen Straße 12 und 13 erinnern wir an Babette „Bettsy“ Bernstein geb. de Levie, ermordet am 9.11.1942 im KZ Auschwitz. An Auguste Gertrud de Levie am gleichen Datum im KZ Auschwitz ermordet. An Henny Silberberg, geb. Heinemann , ermordet am 18.8. 1942 im Ghetto Theresienstadt
- In der Kaiserstraße 7 erinnern wir an Alexander Hirschfeld, ermordet im KZ Kowno. Das Todesdatum kennen wir nicht. An seine Ehefrau Emma Hirschfeld geb. Auerhan, die ebenfalls im KZ Kowno an einem unbekannten Datum ermordet wurde.
- Wir erinnern in der Staustraße 3/ 4 an Samuel „Sally“ Ostro, ermordet vermutlich um den 20.9.1944 im Vernichtungslager Treblinka und an Frieda Helene Ostro mit dem gleichen Schicksal.
- In der Wilhelmstraße 30 erinnern wir an Jutta Meyerhoff geb. Wieneck, ermordet zu unbekanntem Datum im Ghetto Lodz und an. Carla Meyerhoff, ebenfalls im Ghetto Lodz ermordet.
- Die Erinnerungszeichen für die große Familie Insel in der Roggemannstraße 25, von der ich anfangs gesprochen habe, planen wir im Mai in Anwesenheit mit den dann hoffentlich kommenden Nachkommen anzubringen. Ebenfalls werden wir für die zahlreichen Familienmitglieder der Familie de Beer im Zusammenhang mit einer geplanten Veranstaltung einen gesonderten Termin finden. Die Erinnerungszeichen sind bereits fertig.
Meine Damen und Herren,
ich hatte vor zwei Jahren, zu Beginn unserer Aktion, gerade für uns Oldenburger, deren Reichsland das erste Land mit nationalsozialistischer Regierung im Deutschen Reich war, von einer besonderen Verantwortung gesprochen, gerade hier unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder einen sichtbaren und ablesbaren Platz an den Stätten ihrer letzten Wohnung zu geben. Wir markieren mit den Erinnerungszeichen die Wohnungen der Ermordeten, um sie in unsere Stadt zurückzuholen.
Es ist eine Schande und ein unsägliches Zeichen barbarischen Antisemitismus, wenn heute bei den unter uns lebenden Jüdinnen und Juden in einigen Städten mit dem Zeichen des Davidssterns deren Wohnungen markiert werden, um so einmal der Verängstigung, der absoluten Verunsicherung und offensichtlich ein mögliches Anschlagsziel zu adressieren. Der so manifest werdende Antisemitismus ist – neben dem Antisemitismus alter Prägung, der sich jetzt bei uns neu entfaltet – aktuell größtenteils ein importierter, über arabisch-palästinensische Gruppen hereingetragener Angriff auf jüdisches Leben und „jüdisches Hiersein“ in Deutschland. Dies geschieht nach dem barbarischen, alle menschlichen Maße sprengenden terroristischen Überfall der Hamas auf ein Kibbuz am 7. Oktober in Israel. Die Vorstellung der Auslöschung des Staates Israel gemäß dem auf Demonstrationen gezeigten Motto: „From the River to the sea, Palestine will be free.“ negiert den Kern unserer nach dem Holocaust angenommenen deutschen Verantwortung und Staatsraison, eine Schutzmacht der Existenz Israels zu sein. Sie trifft auch den Kern unserer jetzt mühsam entwickelten Erinnerungskultur, in der wir endlich Verantwortung für unsere Geschichte und für die Existenz unserer hier und jetzt lebenden jüdischen Mitbürger angenommen haben. Eine Revision dieser Geschichte und eine Ausklammerung eines wichtigen Teils unserer Gesellschaft lassen wir nicht zu. Wer Mitglied unseres Staatsverbandes als deutscher Staatsbürger sein will, muss sich auch unserer Geschichte stellen. Wer bei uns die sunnitische Hamas oder die schiitische Hisbollah als Befreiungsarmee zur Befreiung und damit zur Vernichtung Israels begreift, stellt sich gegen einen Kernbereich unserer von fast allen Parteien getragenen Staatsraison. Es gibt in der Frage der Existenz und des Fortbestehens des Staates Israel kein ja, aber – auch nicht bei nicht akzeptierter Siedlungspolitik oder einer kritisierbaren Justizpolitik. Es kann auch keine Äquidistanz zu Israel und den Palästinensern geben, wenn es um die Frage der Existenz Israels geht.
Es gilt der alte Sponti-Spruch: In Gefahr und großer Not, ist der Mittelweg der Tod. Vielleicht gilt dies auch bei Abstimmungen in der UNO.
Ich habe gerade stärker vom importierten Antisemitismus gesprochen. Dies mag die Zunahme des aktuell auftretenden Antisemitismus erklären. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass innerhalb unserer Gesellschaft immer noch aus unserer eigenen Vergangenheit und neu befeuert ein nicht unerheblicher Anteil von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und auch antimoslemischen Haltungen gepflegt wird. Jeder, der sich dieser Haltung entgegenstellt, verdient unsere Unterstützung. Ich habe deshalb den Aufschrei in den Leserbriefspalten unserer Presse nicht nachvollziehen können, bei der unserem Polizeipräsidenten von nicht wenigen inklusive eines hiesigen Hochschullehrers eine pflichtwidrige Verletzung des Neutralitätsgebots vorgeworfen wurde. Er hatte auf Tendenzen innerhalb der AfD hingewiesen, die mit der Verfassung kollidieren. Was ist denn die Betonung von völkischen Grundpositionen anderes als ein Ausklammern und Ausgrenzen anderer Menschen und deren Würde. Natürlich sind Beamte der Neutralität gegenüber allen Parteien verpflichtet. Das entbindet sie aber nicht davon zu schweigen, wenn Entwicklungen eintreten und sie beobachtet werden, die der Demokratie und unserem Zusammenleben gefährlich werden können.
„Demokratie ist nur dort mehr als ein Produkt einer bloßen Zweckmäßigkeitsentwicklung, wo man den Mut hat, an sie als etwas für die Würde des Menschen Notwendiges zu glauben. Wenn man aber diesen Mut hat, dann muss man auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“ hat Carlo Schmid, der große Staatsrechtler und Politiker aus dem Anfang unserer Republik gesagt.
Ich füge hinzu, dann kann und darf man nicht neutral sein. Wir werden denjenigen nicht die Hand reichen, die unseren Grundkonsens angreifen, um ihn zu zerstören. Im Gegenteil, sie fordern unseren massiven Widerstand heraus.
Die Bundesregierung hat erfreulich klar und deutlich zusammen mit fast allen Teilen der Opposition die aus unserer Geschichte hergeleitete Staatsraison auf das Existenzrecht Israels in diesen Zeiten des Krieges betont und danach gehandelt. Für unsere Erinnerungskultur bedeutet dies ebenfalls, dass wir der ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter gedenken und sie in unsere Stadt zurückholen. Für die unter uns lebenden Jüdinnen und Juden bedeutet dies, dass wir es nicht zulassen, dass sich diese Geschichte wiederholt. Unsere Erinnerungsarbeit soll auf das „Nie wieder“ hinarbeiten.
Und so soll es bleiben! „Nie wieder!“